


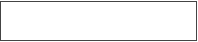

DAS MAß DER KÄLTE
Jeder,
der
in
den
letzten
Wochen
aus
dem
Fenster
geschaut
hat,
hat
sicher
Freude
gehabt.
Ein
Winter
mit
tiefen
Temperaturen.
Es
hingen
Eiszapfen
auf
den
Dächern,
der
Schnee
hat
geglitzert
und
geknirscht,
wie
er
es
nur
bei
minus
10°
bis
minus
20°C
tut.
Die
Bäche
vereisen
spektakulär,
die
Luft
ist
ganz
trocken,
die
Aussicht
von
den
Bergen
unvergleichlich.
Die
Mürz
war
weithin
zugefroren,
die
Singvögel,
die
über
den
Winter
in
diesen
Breitengraden bleiben, haben einen hohen Bedarf an Zusatzfütterung gehabt.
Es
scheint
ein
ganz
normaler
Winter
zu
sein
und
doch
wird
medial
immer
nach
dem
Superlativ
gesucht:
„Im
Tiefland
Österreichs
kältester
Jänner
seit
neun
Jahren.“
schreibt
beispielsweise
die
GeoSphere
Austria
auf
ihrer
Seite.
Sie
könnte
auch
schreiben:
„Ein
etwas
kälterer
Jänner
als
durchschnittlich.“
(Klimaperiode
1991-
2020)
-
das
lässt
sich
aber
vielleicht
nicht
ganz
so
reißerisch
verkaufen,
wie:
„
…
und
auf
den
Bergen
war
es
um
0,6
°C
zu
kalt.“
Zu
kalt?
Die
Temperaturkurve
wird
niemals!
exakt
dem
Schnitt
folgen,
gerade
Ausreißer
formen
ja
auch
den
Schnitt!
Aber
wenn
man
den
Betrachtungszeitraum
jedes
Mal
neu
festlegt
und
dabei
so
klein
wie
möglich
macht,
wird
immer
ein
Superlativ
zu
finden
sein.
Deswegen
erachte
ich
es
als
nicht
ganz
angebracht
immer
von
zu
hohen
oder
zu
niedrigen
Temperaturen
zu
sprechen.
Wir
wissen
aber
ohnedies
alle,
dass diese Formulierungen anderen als wissenschaftlich - meteorologischen Gründen geschuldet sind.
Der
MÜRZPANTHER
allerdings
freut
sich
über
diesen
Jänner,
über
die
Eisblumen
an
Türen
und
Fenstern,
über
den
Reif
auf
den
Bäumen,
den
Sträuchern.
Die
Landschaft
bekommt
eine
unwirkliche
Komponente,
die
malerisches
hat,
die
Temperaturmessung
hingegen
ist
und
bleibt
der
Wissenschaft
vorbehalten.
Und
über
genau
diese
physikalische
Größe
hat
aufgrund
der
Jännertemperaturen
der
MÜRZPANTHER
bei
Thomas
Wostal
von der GeoSphere Austria um ein Interview angefragt.
dMP: Wie viele Messstellen in der Steiermark gibt es für die Ermittlung der Temperatur?
Thomas
Wostal:
Im
Messnetz
der
GeoSphere
Austria
gibt
es
rund
40
teilautomatische
Wetterstationen
in
der
Steiermark,
an
denen
rund
um
die
Uhr
die
Temperatur
erfasst
wird
(und
andere
Parameter).
Weiters
gibt
es
Temperaturmessungen
im
Rahmen
der
Messnetze
anderer
Anwendungsbereiche,
z.B.
Lawinenwarndienst,
Hydrografischer Dienst etc.
dMP:
Seit
wann
gibt
es
die
teilautomatischen
Wetterstationen
(TAWES)
und
die
vollautomatische
Wetterstationen (VAMES)?
Thomas
Wostal:
Erste
teilautomatische
Wetterstationen
gab
es
Ende
der
1980er-Jahre.
Die
erste
Ausbaustufe
des
TAWES-Messnetzes
gab
es
1992.
Die
erste
Ausbaustufe
des
VAMES-Messnetzes
begann
2011.
Bei
VAMES
geht
es
in
Zusammenarbeit
mit
der
Austrocontrol
vor
allem
um
die
automatische
Messung
von
für
die
Luftfahrt
wichtigen
Elementen
wie
Sichtweite,
Niederschlagsart,
Wolkenuntergrenze
etc.
Viele
Wetterstationen
waren
aber
natürlich
schon
lange
vor
der
(Teil-)Automatisierung
in
Betrieb.
Zum
Beispiel
besteht
die
längste
Temperaturreihe der Steiermark seit 1837 an der Wetterstation Graz Universität.
dMP:
Werden
für
die
durchschnittliche
Jahrestemperatur
die
durchschnittlichen
Tagestemperaturen
der
Messstellen herangezogen und durch Berechnung ermittelt?
Thomas
Wostal:
Für
z.B.
Monatsbilanzen
wird
das
Monatsmittel
nach
der
Formel
Tmean_month
=
(mean_Tmax+mean_Tmin+mean_T7+mean_T19)/4
berechnet.
Das
Monatsmittel
wird
also
aus
den
Mittelwerten
der
täglichen
Werte
der
Max-,
Min-,
7-Uhr-
und
19-Uhr-Temperatur
berechnet.
Das
Jahresmittel
wird
dann
aus
diesen Monatsmitteln berechnet.
-


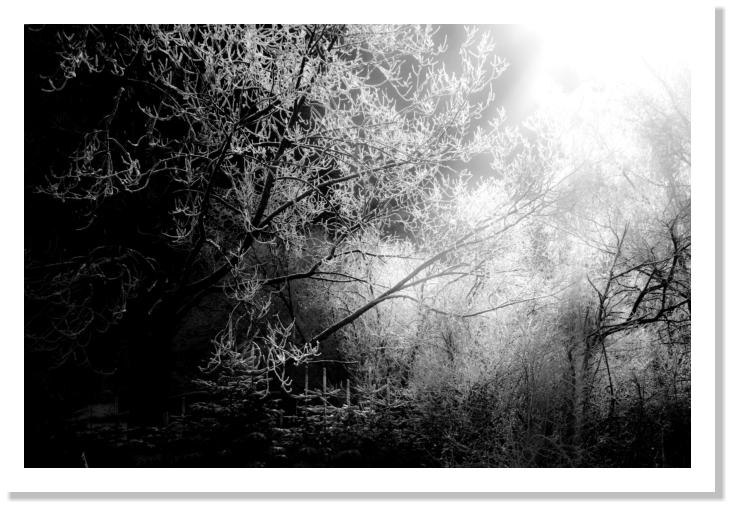
Die Eisschollen habe ich am Attersee entdeckt, der Reif auf den Bäumen bildete sich in meinem Garten.
Fotocredit: der MÜRZPANTHER
Welcher Hundebesitzer kennt es nicht: Die Vierbeiner lieben den
frischgefallenen, weichen Schnee und springen allesamt wie die
Welpen darin herum.
Fotocredit: der MÜRZPANTHER
dMP:
In
welcher
Höhe
wird
gemessen
und
gibt
es
bei
den
Messstationen
Höhenunterschiede?
Dazu:
Unterscheiden
sich
die
Temperaturen
in
20cm
über
dem
Boden
von
jenen,
die
zur
gleichen
Zeit
in
1m
20cm gemessen werden?
Thomas
Wostal:
Je
nach
Wetterstation
sind
alle
oder
einige
der
folgenden
Messhöhen
in
Verwendung:
Über
dem
Untergrund:
2
Meter,
5
Zentimeter.
Im
Boden:
10,
20,
50
Zentimeter.
Ja,
es
gibt
Unterschiede
in
den
verschiedenen Höhen. Sie sind je nach Tages- und Jahreszeit sehr unterschiedlich.
Dieser
Umstand
ist
auch
für
die
Vegetation
von
entscheidender
Bedeutung.
Dazu
meint
die
Botanikerin
Mag.
Margarita
Lachmayer
vom
Naturhistorischen
Museum
Wien
in
einem
Artikel
in
der
Presse
vom
31.
Jänner
2026
„Wie
überlebt
die
Schneerose?“
folgendes:
„
Die
Schneerose
schützt
sich
schon
durch
ihre
Größe
-
sie
wird
selten
höher
als
40
Zentimeter.
Und
sie
steht
in
der
Schneedecke,
meist
umgeben
von
etwas
Laub.
Es
kann
sein, dass es in zwei Metern Höhe minus 13 Grad hat und am Boden nicht viel kälter als Null Grad ist.
“
dMP:
Sind
die
Messstellen
in
der
Steiermark
gleich
verteilt
wie
die
landschaftlichen
Gegebenheiten
des
Landes?
Oder
anders:
Wie
viele
Messstationen
befinden
sich
auf
verbauten
Gebiet
–
wie
viele
auf
natürlichen
Freiflächen,
da
laut
Statistik
„nur“
ca.
22%
verbaut
sind?
Werden
die
Daten
dann
auch
gleich
gewichtet?
Wenn
auf
22%
verbautem
=
städtischem
Gebiet
eine
Messstation
steht
und
eine
im
Wald,
wäre
die
Verteilung
50:
50.
Aber
das
ergibt
den
Durchschnittswert
der
Temperatur
der
Gesamtfläche
der
Stmk
ja
verfälscht,
da
ja
der
Anteil
der
Stadt
nur
22%
ist!
Beeinflussen
Häuser
und
asphaltierte
Straßen
die
Messungen?
Thomas
Wostal:
Die
teilautomatischen
Wetterstationen
stehen
nach
Möglichkeit
auf
Wiesen
und
möglichst
wenig
beeinflusst
von
Gebäuden,
aber
sie
benötigen
Strom-
und
Telekommunikationsanbindung.
Daher
können
die
Messstellen
nicht
gleich
verteilt
sein
wie
die
landschaftlichen
Gegebenheiten
der
Steiermark.
Das
ist
aber
für
viele
Anwendungen
bzw.
Fragestellungen
auch
nicht
notwendig.
Zum
Beispiel
haben
langfristige
Änderungen
der
Temperatur
eine
sehr
hohe
Korrelation
über
die
gesamte
Fläche
Österreichs
hinweg.
Denn
wenn
das
Klima
in
Österreich
wärmer
wird,
wird
es
überall
in
einem
ähnlichen
Ausmaß
wärmer,
egal
ob
in
der
Stadt,
auf
der
Wiese,
im
Wald
oder
am
Berg.
Ein
gutes
Vergleichsbeispiel
mit
hochwertigen
Messungen
sind
zum
Beispiel
Bergstationen
wie
das
Sonnblick-Observatorium,
wo
seit
1886
in
völlig
gleicher
Umgebung
gemessen wird. Auch hier gibt es eine deutliche Erwärmung in den letzten Jahrzehnten.
dMP:
Nach
Ihrer
Einschätzung:
Fällt
die
gerade
erlebte
Kältephase
(Mürztal:
bis
–
18°C)
im
Jänner
für
den
Jahresdurchschnitt 2026 in`s Gewicht?
Thomas
Wostal:
Wie
jeder
Monat,
wird
auch
dieser
Jänner
mit
einem
Zwölftel
in
den
Jahresdurchschnitt
eingehen.
Ob
es
sich
dabei
um
eine
kleine
Dämpfung
in
einem
insgesamt
sehr
warmen
Jahr
handelt
oder
um
eine
Verstärkung
in
einem
insgesamt
sehr
kühlen
Jahr,
lässt
sich
jetzt
aber
natürlich
noch
nicht
sagen.
Ähnlich
wie
sich
ein
Monat
nach
dem
Start
der
Fußballmeisterschaft
noch
nicht
sagen
lässt,
wie
sich
die
ersten
Spiele
von Sturm Graz auf den Tabellenstand am Ende der Saison auswirken.
Der
MÜRZPANTHER
wagt
einen
Blick
in
die
Zukunft:
Durchschnittlich
wird
dieses
Jahr
nur
die
Temperatur
und
Sturm Graz
MEISTER!

Die Schneerose erfreut nicht nur, sie ist auch ein kleines Wunder der
Natur. Sie überlebt den Winter nicht nur unbeschadet, sie beginnt in
dieser Jahreszeit auch zu blühen! Wie sie das macht? Sie lagert Wasser
aus den Zellen aus, damit sie bei Kristallbildung keinen Schaden
nehmen. Daneben reichern die Zellen Salze, Alkoholverbindungen und
Zucker an, um sich zu schützen, indem sie den Gefrierpunkt von Wasser
herabsetzen.
Fotocredit: Pixabay









