HOPFEN IST KULTUR!
Die
meisten
Österreicher
verbinden
mit
Hopfen
einen
wichtigen
Inhaltsstoff
in
Bier.
Dort
verleiht
er
dem
Getränk
den
etwas
bitteren
Geschmack
und
verleiht
ihm
Noten
von
Kräutern
oder
Gewürzen
und
vielem
mehr.
Aber
bereits
seit
dem
12.
Jahrhundert
weiß
man
auch,
dass
sich
Hopfen
neben
vielen
anderen
Effekten
positiv
auf
die
Darmflora
auswirkt.
Ausschlaggebend
dafür
sind
viele
Polyphenole
wie
Flavonoide
und
Phenolsäuren,
die zu den Antioxidantien gehören und die vor Entzündungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs schützen.
In
Österreich
gibt
es
einen
Verein,
die
Forschungs-Plattform
Phytopharmaka
und
Naturstoffe
Österreich
oder
Herbal
Medicinal
Products
Platform
Austria
(HMPPA),
der
sich
der
Erforschung
und
Entwicklung
von
pflanzlichen
Arzneistoffen
verschrieben
hat
und
die
gewonnenen
Erkenntnisse
zugunsten
der
Patientinnen
und
Patienten
nach
modernsten
wissenschaftlichen
Standards
umsetzt.
Zu
ihrem
Tätigkeitsfeld
gehört
auch
die
Wahl
zur
Arzneipflanze
des
Jahres.
Diese
fiel
heuer
auf
den
Hopfen.
Humulus
lupulus,
so
der
lateinische
Name,
weist
ein
breites pharmakologisches Wirkprofil auf.
Der
MÜRZPANTHER
hat
mit
Assoc.
Prof.
Dr.
Christian
W.
Gruber
von
der
Medizinischen
Universität
Wien
und
Vizepräsident der HMPPA gesprochen, um mehr über diese Pflanze zu erfahren.
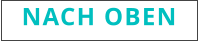
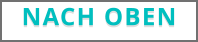




dMP:
Wird
zur
Zeit
geforscht,
welche
Wirkung
Hopfen
tatsächlich
entwickeln
kann?
Die
Wirkungen,
die
angeführt sind, klingen ja beinahe nach einem Wundermittel!
Prof.
Christian
Gruber:
Ja,
es
gibt
Forschungsteams,
die
sich
mit
den
Hopfeninhaltsstoffen
und
deren
Wirkung
beschäftigen.
Für
beruhigende
und
schlaffördernde
Effekte
liegen
gute
Daten
vor,
viele
weitere
Wirkungen
sind
bislang vor allem experimentell untersucht und noch nicht klinisch gesichert.
dMP:
Hat
die
breite
Wirkung
der
Bitterstoffe
Parallelen
zu
jenen,
die
auch
medizinischer
Hanf
aufweist
–
sie
gehören auch zur selben botanischen Familie!
Prof.
Christian
Gruber:
Die
Inhaltsstoffe
und
Wirkungen
von
Hopfen
unterscheiden
sich
grundsätzlich
von
jenen
des Cannabis, auch wenn es einige Überschneidungen gibt.
Eine
interessante
HMPPA
Monografie
von
Prof.
Stuppner
zeigt,
dass
Hopfen
ein
breites
pharmakologisches
Wirk-
profil
aufweist.
Am
besten
belegt
sind
Effekte
auf
Schlaf-
und
Angststörungen,
sowie
auf
Beschwerden
während
der
Menopause.
Andere
Wirkungen,
etwa
antibakterielle,
entzündungshemmende,
metabolische,
neuroprotektive
oder
antikanzerogene
Effekte
sind
überwiegend
experimentell
beschrieben.
Hopfen
wirkt
beruhigend,
schlaf-
fördernd
und
angstlösend.
Deswegen
liegt
der
phyto-therapeutische
Schwerpunkt
in
der
Behandlung
leichter
Schlafstörungen
und
nervöser
Unruhe
(Anm.:
Phytotherapie
ist
die
Anwendung
von
Pflanzen,
Pflanzenteilen
oder
deren Zubereitungen).
dMP:
Es
gibt
weltweit
über
300
Sorten
Hopfen
für
den
unterschiedlichsten
Einsatz
–
beinhaltet
auch
Humulus lupulus diese Wirkstoffe?
Prof.
Christian
Gruber:
Humulus
lupulus,
die
Arzneipflanze
des
Jahres
2026,
beinhaltet
die
für
die
Wirkungen
verantwortlichen
Inhaltsstoffe
die
polyphenolischen
Verbindungen
bzw.
Prenylflavonoide
und
Bitterstoffe;
Sorte,
Herkunft,
Ernte
und
Extraktion
bestimmen
den
Gehalt
der
einzelnen
Stoffe.
Das
Arzneibuch
schreibt
vor,
welche
Qualitätsstandards (d.h. Menge an bestimmten Inhaltsstoffen) zu erfüllen sind.
In
welchem
Teil
der
Pflanze
befinden
sich
aber
diese
Inhaltsstoffe?
Die
wirksamen
Inhaltsstoffe
des
Hopfens
be-
finden
sich
vor
allem
in
den
Drüsenhaaren
der
weiblichen
Blüten.
À
propos:
Hopfen
ist
eine
zweihäusige
Pflanze,
d.h.
dass
männliche
und
weibliche
Blüten
auf
getrennten
Pflanzen
auftreten.
Zum
Bierbrauen
werden
nur
die
weiblichen
Pflanzen
genutzt,
die
durch
vegetative
Vermehrung
vervielfältigt
wird.
Vegetativ
heißt,
dass
sie
nicht
durch
Befruchtung
(generative
Vermehrung)
vermehrt
wird,
sondern
dass
durch
beispielsweise
Stecklinge
idente
Pflanzen entstehen.
.
Prof.
Chlodwig
Franz,
ebenfalls
im
Präsidium
der
HMPPA
meint
erläuternd
dazu:
Als
„Sorte“
bezeichnet
man
eine
gezüchtete
Kulturform
einer
Pflanzenart,
sie
(1)unterscheidet
sich
in
einem
oder
mehreren
(äußeren)
Merkmalen
von
den
anderen
Sorten
derselben
Art,
(2)
ist
einheitlich
und
(3)
ist
stabil
in
den
Merkmalen
über
mehrere
Generationen
(über
Samen
vermehrt
oder
verklont,
d.h.
über
Stecklinge
vermehrt).
Die
erwähnten
über
300
Hopfen-Sorten
gehören
also
alle
zur
Art
Hopfen
(Humulus
lupulus),
sehen
ähnlich
–
aber
nicht
in
allen
Merkmalen
gleich
–
aus
und
haben
prinzipiell
die
gleichen
Inhaltsstoffe
bzw.
Stoffgruppen.
Es
gibt
jedoch
auch
innerartliche
chemische
Vielfalt
(sog.
Chemotypen)
und
damit
Sorten,
die
einmal
die
eine
Substanz
oder
Stoffgruppe,
einmal
eine
andere
verstärkt
ausbilden.
Demnach
können
Hopfensorten
auch
unterschiedliche
Geschmacks-
bzw.
Wirkungs-Schwerpunkte haben.
dMP:
Sind
die
Wirkungen
nicht
bereits
lange
Zeit
bekannt?
Leonhard
Fuchs
beschreibt
bereits
in
der
ersten
Hälfte
des
16.
Jahrhunderts:
„Hopfen
reinigen
das
Blut“
(antibakteriell,
entzündungshemmend),
„Sie
verzehren
auch
allerley
Geschwulst“
(antikanzerogen)
„Treibt
kräftig
den
Stuhlgang“
(metabolisch)
„Der
Hopf
eröffnet
auch
die
Mutter“
(Wirkung
in
der
Gynäkologie
–
Menopause).
(Anm.:
Aktuelle
Untersuchungen
weisen
auf
eine
Reihe
weiterer
potenzieller
Anwendungsgebiete
hin.
Informationen
dazu
finden
Sie
in
der
Monografie Hopfen
von Prof. Stuppner.
Prof.
Christian
Gruber:
Das
Studium
der
Naturstoffe
und
seiner
Wirkungen
hat
lange
Tradition;
bereits
im
alten
Ägypten
(ca.
1550
v.
Chr.)
wurden
Arzneimittelrezepte
unter
anderem
aus
Heilpflanzen,
im
sog.
‚Papyrus
Ebers‘
gesammelt und niedergeschrieben.
Prof.
Chlodwig
Franz:
Heute
wissen
wir
jedoch
wesentlich
mehr
über
die
Hintergründe
dieser
alten
Beschrei-
bungen und können Symptome, Wirkung und Wirksamkeit besser erklären.
dMP:
Wie
entfaltet
Hopfen
die
beste
Wirkung?
Roh,
gekocht,
verarbeitet?
Welche
Konzentrationen
sind
in
der Pharmakologie üblich?
Prof.
Christian
Gruber:
Als
standardisierte
Zubereitung
laut
Arzneibuch;
Hopfenzapfen
können
in
Form
eines
Tees,
der
gepulverten
Droge,
als
Tinktur,
Flüssig-
oder
Trockenextrakt
eingenommen
werden.
Für
die
Teezu-
bereitung
werden
0,5 g
Droge
mit
150–200 ml
Wasser
als
Infus
zubereitet.
Pro
Tag
können
bis
zu
4
Tassen
getrun-
ken
werden.
Als
Schlafhilfe
30
bis
60
Minuten
vor
dem
Schlafengehen
1
Tasse
trinken.
Bessern
sich
die
Beschwer-
den
innerhalb
von
zwei
Wochen
nicht
oder
verschlimmern
sie
sich,
sollte
ärztlicher
Rat
eingeholt
werden.
Das
HMPC
(Anm:
Committee
on
Herbal
Medicinal
Products
der
Europäischen
Arzneimittelagentur)
empfiehlt
die
Verwendung
von
Hopfenzapfen
als
Tee
erst
ab
einem
Alter
von
12
Jahren.
Schwangeren
und
stillenden
Frauen
wird
aufgrund
fehlender
Daten
von
einer
Anwendung
abgeraten.
Bei
einer
bekannten
bestehenden
Allergie
gegenüber einer im Hopfen enthaltenen Substanz sollte kein Hopfenpräparat eingenommen werden.
dMP: Wie wird Hopfen zeitgemäß in der ärztlichen Praxis angewendet?
Prof.
Christian
Gruber:
Hopfen
wird
als
traditionelle
Heilpflanze
verwendet.
Das
HMPC
bewertete
Hopfenzapfen
als
traditionelles
pflanzliches
Arzneimittel
und
empfiehlt
ihre
Anwendung
aufgrund
langjähriger
Erfahrung
zur
Besserung
leichter
Symptome
von
Stress
und
als
Schlafhilfe.
Es
gibt
derzeit
keine
pharmakologischen
Zuberei-
tungen,
in
denen
der
Hopfen
oder
deren
Inhaltsstoffe
in
evidenzbasierten
Studien,
wie
z.B.
für
Arzneimittel
üb-
lich, überprüft wurde.
dMP: Herzlichen Dank für das Interview!


Hopfen wird im Anbau zwischen 6 und 8 Metern hoch. Die Pflanze erreicht eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren. Die Hopfendolden
(rechts im Bild) entstehen, nachdem der Hopfen geblüht hat: das nennt man Ausdoldung.
Fotocredit: pixabay
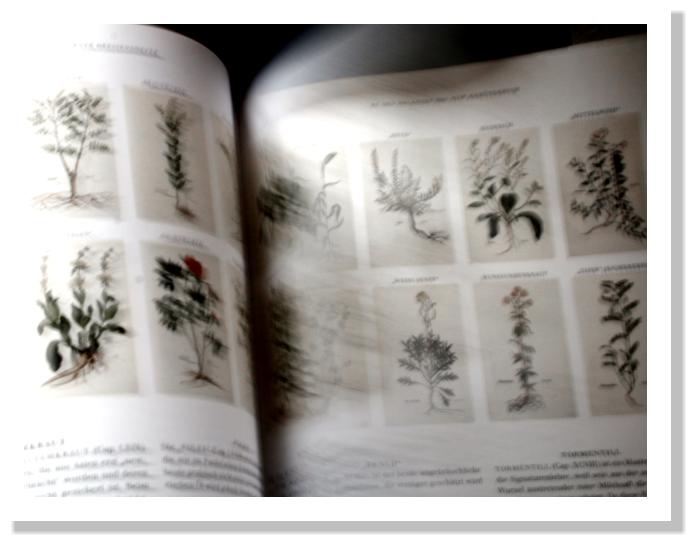
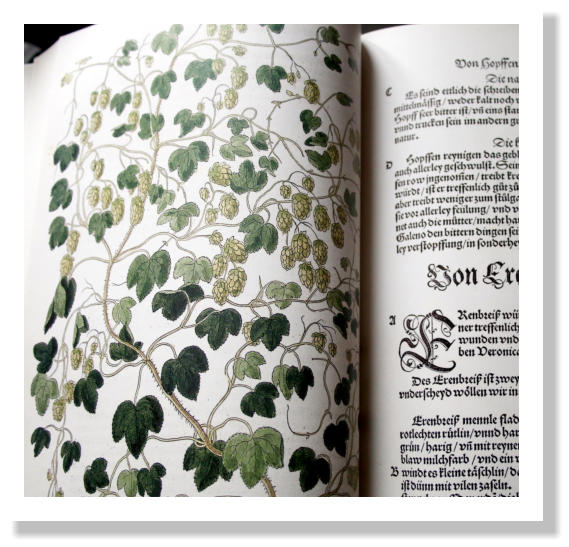
In dieser wunderschönen Faksimile
Ausgabe des New Kreüterbuch
(Taschen Verlag) von Leonhart
Fuchs ist auch im Kapitel „Die
Heilpflanzen von Fuchs in der
modernen Phytotherapie eigens
erwähnt: Hopfenzapfen,
Drüsenschuppen, Extrakt. Tee zur
Appeteitanregung (Bitterstoffe!),
Extrakte zur Beruhigung und bei
Schlafstörungen.
Bildgestaltung: der MÜRZPANTHER











